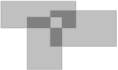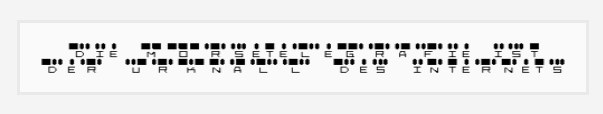
|
| |
Morsen in der
Praxis
Allgemeine Betriebstipps zur Verbesserung des Funkbetriebs
- 500 Hz - Wahl der optimalen CW-Tonfrequenz
- CQ-Tipps - Verbesserung der
Kontaktaufnahmen
- Morse-Saudrücker und Linker-Fuß-Geber
- Hilfen zur Morsetelegrafie bei
Problem-Feldstärken
- Kreative Betriebsnutzung der
SDR-Webradios
- CW-Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb
- Telegrafie-Frequenzeinstellungen
- Flüssiger Funkverkehr durch einen
FULL-BK-Betrieb
- Fachgerechte Anwendung aller
Bedienelemente
- 5 MHz Tipp - Vergrößerung der
Filterbandbreite
- Besondere Z-Gruppen für die
Morsetelegrafie
- Besondere Aufwärmübung für den
Telegrafisten
- Spezielle Q-Gruppen für quarzgesteuerte
Sender
- Tönende Telegrafie auf UKW (F2A) - alternativ
SSB
500 Hz - Wahl der optimalen
CW-Tonfrequenz
Nutze die Erkenntnisse der Psychoakustik und empfange deine
Telegrafiesignale in einer Tonhöhe von ca. 500 Hz! Denke auch
daran, ggf. deinen Mithörton (PITCH-Funktion) entsprechend
einzustellen, damit bei deinem Tranceiver die Töne für ein
korrektes Schwebungsnull (Zero Beat) übereinstimmen. Tiefe Töne
haben einen wertvollen Trennschärfen- und S/N-Gewinnvorteil
gegenüber höherfrequenten NF-Signalen.
Mehr dazu: Telegrafie im Rauschen - Morsen und
Psychoakustik
CQ-Tipps - Verbesserung der
Kontaktaufnahmen
Nach einem CQ-Ruf nicht sofort aufhören!
Entweder wird langsam über das Band "gekurbelt" oder es wird das
leicht verzögerte RBN-System beobachtet.
Ist der Ruf zu kurz, die Frequenz zu schnell verlassen, reicht
häufig die Antwortzeit nicht aus. Daher: Bitte nicht zu kurz rufen
und nicht zu schnell die Frequenz verlassen!
CQ-Rufe auf bekannten Aktivitätsfrequenzen!
Oft parken Stationen in ihren sendefreien Zeiten auf bekannten
Klub-, Aktivitäts- oder
Lieblingsfrequenzen. Daher: CQ auf beliebte Frequenzen erhöhen
oft die QSO-Chance.
Eine Bandöffnung an FTx/Beacons erkennen!
Mitunter beherrschen FTx- oder Beacon-Ausstrahlungen das sonst einsame Band.
Daher: Eine Vorab-Empfangskontrolle dieser Sendungen versprechen
mitunter gute CQ-Erfolgaussichten.
Auch auf einem "toten" Band CQ rufen!
Die Bänder sind manchmal
unberechenbar! Unerwartete
Trassenöffnungen sind nicht außergewöhnlich. Daher: Ein CQ-Ruf
mit einer parallelen RBN-Beobachtung könnte für eine Überraschung
sorgen.
Siehe auch: CQ-Rufe, Anrufe, Anrufantworten und
Skeds
Die "Telegrafenkrankheit"
Morse-Saudrücker und Linker-Fuß-Geber - des Funkers Leid
Ein schlechter Morsegeber wird als "Saudrücker" (QSD) bezeichnet. Netter, aber nicht viel
besser, klingt "Linker-Fuß-Geber" (QLF). Zu viele Gebefehler und ein
ungeliebtes "Stottermorsen" erschweren den Funkverkehr. Kurzum: Es
wird hier meist zu viel geschmiert und viel zu schnell gegeben. Die
Morsepunkte rutschen durch und die jeweiligen Abkürzungen oder
Wörter werden zeitlich auseinander gerissen.
In dieser "Stolpertelegrafie" werden die Morsezeichen (viel)
schlechter verstanden.
1. Schmieren - Nichteinhaltung von Buchstaben- und
Wortabständen:
"q dr Ø= rv5 795 79 =
qtheus kirche neu skirchen = xm elud wig"
Normgerechte Abstände werden nicht eingehalten. "GT" (Guten Tag)
wird zu "Q", der "OM" (old man) wird zur traurigen "Ø" und "RST"
ergibt "RV" oder Phantasiezeichen. Der Funker schmiert, sein Morsen
wird unverständlich. Falsche Abstände verbeulen die Sprache und
verwirren. Der Hörer wird frustriert, er ermüdet und ein schnelles
"QSL 73" wird herbeigesehnt, eine längere Unterhaltung
vermieden!
2. Zu schnell - Nichtbeherrschung der eingestellten
Morsegeschwindigkeit:
"gt br om x rht 579 hz9 x qt5 euhksrc5en euskerchen x nami
ludwsg"
Punktesalat! Das Tempo wird nicht beherrscht. Punkte "rutschen oder
blockieren". Die elektronische Taste ist für den Funker zu schnell
eingestellt. Er telegrafiert auf Kosten der Gegenstation.
Egoistisch möchte er flott erscheinen und auf Biegen und Brechen
ebenso schnell sein. Anspruch und Wirklichkeit klaffen dabei weit
auseinander. Hier sind dann die sprachlichen Redundanzfähigkeiten
mithörender Funker gefordert.
Esne vnleherlic5e Morheic5rift uervirrt e6en!
Treten beide beschriebenen Formen gemeinsam auf, wird es noch
problematischer! Dies geschieht gern bei den berüchtigten
"Windhund-Telegrafisten", die meist ohne ausreichende Übung und
Konzentration zu ungenau und viel zu schnell morsen.
"q br Ø= rv 57 9hz 9x qt5
eus kirc5e neu skerchen xmel udwsg"
Zugegeben: Schon sehr übertrieben! Aber leider nicht ganz so
praxisfremd!
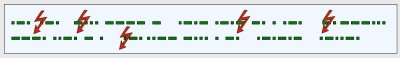
So bleibt es dann bei einem ungeliebten "Redundanz-QSO" mit einer
nachfolgenden QSO-Vermeidungshaltung. Hackende QLF-Funker bleiben
daher meist einsam!
Gegenmaßnahme: Bitte bei QSD/QLF um
ein (viel) langsameres Geben (QRS)!
Siehe auch: Die individuelle
Morsehandschrift und die Ursachen
Aber wie können eigene QSD/QLF-Fehler vermieden werden?
Langsamer Geben
Ein wenig Bescheidenheit erfreut den Partner! Warum nicht einfach
langsamer geben? Fehlerfreies Morsen erhöht den Genuß und die
Akzeptanz, besonders bei schwachen Signalen (QRP). Wer liebt nicht eine perfekte
Morsehandschrift? Ermüdet und verwirrt uns nicht auch ein hektisch
unsauberes Sprechen? Das gilt ebenso für das Morsen!
Gebe-Trockenübungen
Das perfekte Geben im Morsen lernen! Perfekte Funker morsen zur
Übung und ohne HF-Abstrahlung oft seitenweise Texte. Das
Gebe-Wortgefühl wird gestärkt, korrekte Abstände antrainiert. Das
Ziel ist das Erreichen des
Flows! Dabei sollten aus dem Morsealphabet auch seltene Elemente
einbezogen werden. Kein Musiker geht ohne Übung oder kurze Aufwärmung vor das Publikum. Und was macht der
Telegrafist?
Gebe-Trockenübungen mit Hilfe eines Morse-Decoders
Eine Überprüfung und Verbesserung der eigenen Zeichen kann auch mit
einem Freeware-Morsedecoder erfolgen. Nähere Tipps dazu hier.
Klartext-Hörübungen mit dem Computer oder dem Smartphone
Verschiedene Morseprogramme
können zusätzlich eigene, freie Textfiles zur Übungs-Morseabgabe
verwenden. Verbreitete Textprogramme helfen bei einer notwendigen
Konvertierung in das dafür notwendige txt-Format. Wichtig dabei:
Die Verinnerlichung der rythmischen "Morsetakte" kann sich auf die
Gebefähigkeit übertragen - die Fehler verringern sich, die
Morsetelegrafie wird zur Musik!

|
Immer Sauberkeit vor
Schnelligkeit! - Niemand möchte als "Saudrücker" oder als
"Linker-Fuß-Geber" bezeichnet werden. Wir sind Amateure und
erfreuen uns an den Morsezeichen. Daher ist der Hamspirit Ehrensache! Gegenmittel: "nil ok pse
QRS". |
Hilfen zur
Morsetelegrafie bei Problem-Feldstärken
Häufig ergeben sich im Funkbetrieb sehr schwache, bzw. durch
schlechte atmosphärische Bedingungen (QRN), gestörte Signale an der
Hörgrenze. Unabhängig von den Tricks bei Störungen (QRM) ergeben
sich auch hier funkbetriebliche Möglichkeiten.
Problem: Wie sind diese Verbindungen betrieblich zu retten?
Lösung: Durch Nutzung/Umsetzung geeigneter Q-Gruppen.
QRS - Um QRS bitten und/oder selbst langsamer geben.
Langsameres Geben verbessert die Lesbarkeit bei schlechten Verbindungen
erheblich. Bedenke dabei: Es ist immer(!) der Empfänger das Ziel -
nicht die (eigene) Morse-Eitelkeit!
QRO - Um QRO bitten und/oder selbst Leistung erhöhen.
Manche Stationen arbeiten - trotz leistungsfähiger Station - oft
mit (viel) kleineren Leistungen. Dies ergibt sich durch einen
sportlichen Reiz (QRP) oder einer
Notwendigkeit zur Leistungsreduzierung (bci/tvi). Eine (kurze)
Leistungserhöhung - sei es auch nur um wenige Dezibel - kann die
Lesbarkeit erheblich verbessern.
QSZ - Um QSZ bitten und/oder selbst doppelt geben.
Liegen sehr geringe Feldstärken bei gleichzeitigen
Schwundbedingungen (QSB) vor, ist das doppelte (oder mehrfache)
Geben eines jedes Wortes oder jeder Abkürzung ein gutes
Hilfsmittel. Auch wenn dies ungewohnt ist - in den Schwundbergen
kann es vielleicht verstanden werden. Zusätzlich helfen die
CW-Abkürzungen für Fragen und Wiederholungen bei
Störungen.
QSY - Um Frequenzwechsel bitten oder nachfragen.
Frequenzwechsel auf das nächst
tiefere oder höhere Amateurfunkband. Liegen geeignete ionosphärische Bedingungen vor, kann ein
Funkverkehr auf mehreren Amateurfunkbändern möglich sein. Hieraus
ergeben sich gleichzeitig veränderte Signal-/ Rauschverhältnisse.
Die Qualität einer Funkverbindung kann sich damit verbessern.
Wichtig ist: Ergibt sich nach einem
Frequenzwechsel kein Funkkontakt, wird nach einigen längeren
Anrufversuchen auf die vorhergehende (zuletzt funktionierende)
Frequenz geschaltet.
In allen Fällen sollten langatmige Erklärungen vermieden werden.
Bei betrieblich schwierigen Verbindungen sind kurze Durchgänge und
korrekte Abkürzungen das wichtigste Mittel. Ein gekonnter Zwischenhörverkehr (QSK) ist dabei sehr hilfreich.
Siehe auch: Betriebstechnik bei der Verwendung kleiner
Sendeleistungen (QRP)
Kreative Betriebsnutzung der
SDR-Webradios
Neben den oben genannten betrieblichen Hilfen bei
Problemfeldstärken, sowie der betrieblichen WEBSDR-Alternative bei starken
lokalen EMV-Störungen, kann das WEBSDR bzw. das KiwiSDR auch bei
sehr schwierigen Verbindungen oder für besondere (Sked-)Anwendungen
aktiv genutzt werden.
Empfang bei Störungen oder schlechtem Funkwetter
Werden die Fremdstörungen zu stark, sind die Funkbedingungen zu
schlecht, sind die Empfangsfeldstärken zu schwach, kann das Signal
des Partners über einen, seinem Standort nahen bzw. günstig
gelegenen, Internet-SDR empfangen werden ("Webradio-Diversity").
Statt des eigenen Empfängers wird hier ergänzend ein geeigneter
Internet-Empfänger über die Browser-Oberfläche des Rechners
genutzt.
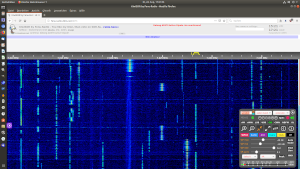
Verbindungen innerhalb der Toten Zone
Auch wenn es verrückt erscheint, Verbindungen können auch innerhalb
der Toten Zone mit Unterstützung der WEB-Empfänger durchgeführt
werden. Die einzige Bedingung ist: Der oder die SDRs müssen
empfangsseitig für beide Stationen außerhalb ihrer gemeinsamen
Toten Zone liegen. Es wäre damit eine geeignete Empfangslösung,
sollte ein Kontakt kurz vor dem Abbruch stehen, plötzlich in den
Tiefen der Toten Zone verschwinden. Auch wäre als Beispiel bei
einem schwachen Backscatter-Signal innerhalb der Toten Zone ein
brauchbarer Kontakt über einen WEB-Empfänger im Ausland
denkbar.
Verbindungen über große Distanzen auf ungeeigneten Frequenzen
Total verrückt, jedoch technisch nicht abwegig ist es, wenn
beispielsweise eine Station mit einem viel zu weit entfernten
Partner auf einer völlig ungeeigneten Frequenz eine Verbindung
abwickelt. Hört zum Beispiel eine US-Station auf einem dem
DL-Empfänger nah gelegenen Webradio, und die DL-Station hört
gleichzeitig auf einem dem US-Empfänger nahen Webradio, wäre eine
Mittagsunterhaltung mit echtem Kurzwellensound auf 80m oder 40m mit
dieser neuen Technik denkbar - quasi als Online-Morsen mit Hochfrequenz. Und
damit es für die anderen Funkamateure nicht verwirrend klingt,
könnte es im QSO regelmäßig mit "QSX WEBSDR [Name]" vermerkt werden.
Geeignet für Sked-Verbindungen ist dieser betrieblichen Kreativität
keine Grenze gesetzt, ob total verrückt oder auch nicht.
Erwähnenswert ist hier das Programm CATSYNC von
DJ0MY, welches die Steuerung eines WEBSDR, KIWI und Open Web RX
durch den eigenen Transceiver erlaubt.
CW-Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb
Problem: Suche nach guten Bekannten auf
Vorzugs-/Treffpunktfrequenzen.
Wer hat es nicht schon erlebt? Man sitzt im Shack und bastelt
einsam, möchte aber gleichzeitig für gute Freunde erreichbar sein.
Viele Treffpunkte sind bekannt. seien es die typischen Klub- oder
Gruppentreffpunkte oder auch persönliche "Hausfrequenzen" - aber
der Transceiver steht leider nur auf einer Frequenz.
Moderne Geräte bieten heute die Möglichkeit des "Memory Scrolls".
Besteht bei einer anderen Tätigkeit gleichzeitig die Lust auf eine
Funkverbindung, ist ein automatisches Abscannen der bekannten oder
bevorzugten Treff-Frequenzen geradezu
ideal. Und sollte es zu nervig werden, kann die HF-Laufstärke
soweit verringert werden, dass das Rauschen in den Hintergrund
tritt oder es kann eine vielleicht vorhandene, knapp eingestellte
Rauschsperre genutzt werden.
Beispielhaft können folgende Frequenzen gescannt
werden:
(Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!)
80 Meter
|
Nutzung
|
40 Meter
|
Nutzung
|
3525 kHz
|
HSC-International
|
7017 kHz
|
BUG-Aktivität
|
3547 kHz
|
Bug-Aktivität
|
7024 kHz
|
QRQ
|
3555 kHz
|
QRS-Aktivität
|
7025 kHz
|
HSC-International
|
3560 kHz
|
QRP-Anruf
|
7030 kHz
|
QRP-Anruf
|
| 3563 kHz |
AGCW-Klub |
|
|
| 3567 kHz |
QRQ |
|
|
BUG-, QRP- und/oder
QRQ-Fans können auf diese einfache Weise
im Hintergrund ihre Lieblingsfrequenzen - je nach Vorliebe -
beobachten! Ungehörte CQ-Rufe
verringern sich - der größeren Aktivität ist Genüge getan!
Neben dieser klassischen Scanfunktion haben einige moderne Geräte
auch einen programmierbaren Bandsuchlauf. Mit einer einstellbaren
Suchlaufgeschwindigkeit kann ein frei wählbarer Frequenzabschnitt abgetastet werden.
Morsesignale sind dadurch schneller erkennbar. Diese Funktion
eignet sich besonders für "einsame" Morsebereiche.
Siehe auch: Stand-By-Betrieb - Stille
Empfangsbereitschaft
Die
Telegrafie-Frequenzeinstellung
Die Morsetelegrafie ist eine schmalbandige Betriebsart.
Besonders für den störungsarmen Morsebetrieb sind exakt
übereinstimmende Sendefrequenzen erforderlich. Sendet ein Partner
frequenzversetzt, ist die Gesamtbandbeite der Verbindung
vergrößert. Eine Frequenz kann frei erscheinen, obwohl sie belegt
ist. Gegenseitige Beeinflussungen sind die Folge. Zur Vermeidung
von Störungen durch Frequenzablagen ergeben sich folgende
Hilfen:
Moderne Transceiver
Bei vielen modernen Transceivern liegt eine genaue
Frequenzübereinstimmung bei identischer Tonhöhe des Mithörtons und
des empfangenen Signals vor. Sind beide Töne gleich (in
Schwingung), stimmt die eingestellte Frequenz überein!
Ältere Transceiver
Ist dieses Hilfsmittel nicht gegeben, kann die passende
Empfangstonhöhe mit Hilfe eines exakt auf einer bekannten Frequenz
arbeitenden Senders bestimmt werden. Auch kann bei korrekter
Frequenzeinstellung die genaue Schwebungsablage einer regelbaren
Empfängerverstimmung
(Clarifier, RIT) bestimmt werden. Eine kleine, zusätzlich
angebrachte Markierung kennzeichnet ggf. das genaue Schwebungsnull
(Zero Beat) zur späteren Einstellkontrolle.
Getrennte Sende-/Empfänger - "Einpfeifen"
Bei getrennten Sende-/Empfängern erfolgt die Einregelung auf die
gemeinsame Frequenz durch das berühmte "Einpfeifen". Hierbei wird
der Sender bei vermindeter Abstimmleistung hörbar und schnell auf
das Schwebungsnull des Empfängers gezogen. Hierbei ist ggf. eine
eingestellte Hörablage des Empfängers zu beachten.
Frequenzbestimmung im SSB-Modus
Wird ein Telegrafiesignal statt im CW-Modus im SSB-Modus (USB/LSB)
empfangen, liegt die wahre Frequenz genau im Schwebungsnull (Zero
Beat) des Signals. Wird z.B. das Signal mit einer Tonhöhe von 1 kHz
empfangen, so ist im oberen Seitenband (USB) die Frequenzanzeige um
1 kHz tiefer, im unteren Seitenband (LSB) dagegen 1 kHz höher. Die
gehörte Tonlage bestimmt somit die Abweichung zur
Grundfrequenz.
Korrekturen im Funkbetrieb
In der Praxis zieht entweder einer der Funkpartner auf die Frequenz
nach oder er bittet z.B. um "200 Hz up" oder "dwn". Wird der
Frequenzversatz jedoch beibehalten, ist eine ungewollte Störung
durch andere, schmalbandig arbeitende Telegrafisten, nicht
auszuschließen.
Flüssiger Funkverkehr durch einen
FULL-BK-Betrieb (QSK)
Problem: Wunsch nach Unterbrechungsmöglichkeiten
Morseverkehre finden grundsätzlich im SIMPLEX-Betrieb
(Wechselsprechen) statt. Hierbei wird abwechselnd eine Frequenz im
Wechsel genutzt.
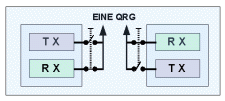
In der klassischen Variante sind keine Unterbrechungen des Partners
möglich. Es muss bis zum Ende der jeweiligen Aussendung gewartet
werden.
Beim amateurfunktypischen VOX-Betrieb (Tastgesteuerter Betrieb /
Semi- oder auch Halb-BK) wird der Sender automatisch mit Beginn des
ersten Morsezeichens aktiviert. In längeren Tastpausen schaltet das
Gerät - in Abhängigkeit von der eingestellten Verzögerung -
automatisch auf Empfang. Bei flüssiger Morse-Gebeweise ist jedoch
auch hier keine Unterbrechung des Funkverkehrs möglich. Ein
Zwischenhören erfolgt nur bei kurzen Verzögerungen in der laufenden
Durchgabe.
Die perfekte Lösung ergibt sich im Zwischenhörverkehr (QSK- oder
FULL-BK- Verkehr), bei dem durch eine spezielle
Sende-/Empfangsumschaltung (TR-Switch), ein reales zwischen den
Zeichen hören möglich wird.
Dem Partner kann dies vorab durch die Abkürzung "QSK" mitgeteilt werden:
"Ich kann Sie zwischen meinen Zeichen hören; Sie können mich
während meiner Übermittlung unterbrechen." Betriebsbeispiel: "
[...] de DK5KE QSK pse k".
Im Funkbetrieb wird formal mit der Duchgabe von "bk" ("Break"; ggf.
auch mehrmals hintereinander) unterbrochen. In lockeren
Funkgesprächen wird dagegen auch mit einfachen
Unterbrechungs-Punkten "dit dit dit ..." auf sich aufmerksam
gemacht. Auch wird das "bk" zum schnelleren Hin und Her (z.B. als
formlose Übergabe bei kurzen Fragen) anstelle eines langatmigen
"Call de Call pse k" verwendet, wobei der Partner seinen Durchgang
ggf. "gespiegelt" ebenfalls mit einem "bk" beginnt.
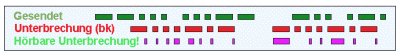
Der Vorteil des QSK- oder FULL-BK-Betriebs liegt in der
unmittelbaren Reaktion hinsichtlich eines Fremdstörers (QRM) oder
einer Unterbrechung des Partners, die ein flüssiges, lebhaftes
Gespräch erst perfekt macht. Das häufige und unabsichtliche
"Doppelsenden" entfällt.
QSK ist jedoch nicht immer QSK! Qualitätsunterschiede in den
Geräten können den Telegrafiegenuss beeinträchtigen. Eine schlechte
QSK-Geräteeigenschaft kann zum Teil durch eine gute Tast-
Elektronik kompensiert werden. Ein verzerrtes Punkt-/
Strichverhältnis kann damit nachgeregelt werden. Wichtig ist
hierbei: Nicht jedes Gerät ist für den perfekten Telegrafiebetrieb
gleich gut geeignet!
Tipp: Der
(QSK-)Morsegenuss ist ideal, wenn bei einem Partner die
HF-Lautstärke soweit zurückgedreht ist, dass das Rauschen gerade
noch zu hören ist, die NF-Lautstärke dagegen auf eine angenehme
Hörlautstärke eingestellt ist. Je nach Gerät oder auch nach
persönlichem Geschmack kann es dabei vorteilhaft sein, die AGC
völlig abzuschalten, da durch das ständige Auf- und Abregeln ein
"Pumpeffekt" entstehen kann, welcher ggf. störend wirkt.
Vorteilhaft für den Genuss kann auch sein, dass leise und störende
Hintergrundsignale (QRM) in Pausen nicht hochgeregelt werden. Und
sollten Umschaltrelais während den einzelnen Morseimpulsen zu laut
klappern, könnten diese - bei Telegrafisten praxiserprobt - mit
Schaumstoff oder Klebepats bzw. Klebeknete bedämpft werden.
Fachgerechte Anwendung aller
Bedienelemente
Problem: Der Funker quält sich mit einer ungenügenden
Hörqualität.
Bedenke: Es gibt hier gute Stellschrauben - aber es gibt auch
Grenzen.

|
Oft liegt es an der mangelnden
Nutzung vorhandener, nicht beachteter - jedoch sehr hilfreicher
Bedienelemente. Gerade diese begründen den besonderen
Morsegenuss!
Das große Ziel ist die Beherrschung aller vorhandenen
Bedienelemente. |
Quarzfilter - HF-Filter
Bei der Partnersuche ruhig breitbandig - im Funkbetrieb aber immer
schmalbandig. Filter kleiner gleich 500 Hz sind zu empfehlen. Ein
ergänzendes Niederfrequenz-Filter kann zudem den Hörgenuss
verbessern. Ein auftretendes "Klingeln" des Filters ist dann jedoch
ein Zeichen einer zu schmalen Einstellung.
NF- und HF-Lautstärke
Die ausgeglichene Balance zwischen dem NF- und HF-Signal begründet
ein ruhiges und ablenkungsfreies Signal. Leichte Fremdstörungen
(QRM), Atmospherik (QRN) oder das Rauschen können mitunter so
minimiert werden, dass Morsesignale fast wie aus der Retorte
klingen. Also: HF so gering wie möglich - NF so laut wie nötig.
Abschwächerschalter (AIT)
Ähnliches bewirkt eine vorhandene, einschaltbare
Empfänger-Eingangsdämpfung für einen verbesserten Intercept-Punkt
durch starke benachbarte Signale.
Frequenzablage RIT (Receiver Incremental Tuning)
Kleine RIT-Frequenzablagen können bei Störungen (Störer auf
Schwebungsnull!) oder bei einem ungewollten Frequenzversatz des
Funkpartners sehr sinnvoll sein. Mit der RIT kann dabei die
gewünschte Tonhöhe (± 500 Hz) eingestellt werden, ohne dass bei
einer eigenen Frequenzkorrektur der Partner (gerätebedingt?!)
erneut im Versatz liegt.
NOTCH-Filter
Liegt bei Nutzung eines schmalbandigen Filters eine (längere)
Fremdstörung vor, sollte zusätzlich ein vorhandenes NOTCH-Filter
genutzt werden. Ein störendes Signal kann damit abgeschwächt
werden, ein entspanntes Morsen ist die Folge.
Störaustastung - Noise Blanker (NB)
Die Nutzung ist primär abhängig von der elektronischen
Umweltverschmutzung. Sie ist sehr sinnvoll bei breitbandigen
(lokalen) Störsignalen. Mitunter beschrieben: Hierbei können, je
nach Einstellung, auch Beeinflussungen in der Qualität der
empfangenen Morsetastungen erfolgen.
Rauschsperre
Für den Betrieb auf Kurzwelle eher ungewöhnlich! Aber: Sie kann
sehr gut für einen "Pausenempfang" auf den bevorzugten Stand-By-Frequenzen oder im Kanalspeicher-Durchlaufbetrieb eingesetzt
werden.
Automatische Schwundreglung (AGC)
Sie sollte grundsätzlich auf einen Wert eingestellt sein, bei dem
das Signal angenehm ruhig und ohne starke Pump- /Regelungseffekte
zu hören ist. Lediglich beim Empfang schwacher Signale erweist sich
eine schnelle Regelung mitunter als vorteilhaft. Siehe hier auch
den QSK-Tipp.
Flankenverschiebungen in den Empfangssignalen
(Bandpass-Shifting)
Die ergänzenden Tiefen- und/oder Höhenbeschneidungen im
Bandpass-Shifting lassen störende Nebengeräusche schnell
verschwinden. Die Bandbreite wird dadurch wie in einem Filter
eingeschränkt, ein hilfreiches Zusatzmittel.
Nicht alle diese Hilfsmittel sind bei den Funkgeräten vorhanden.
Jedoch erleichtern schon einzelne Maßnahmen den Morseverkehr.
Wichtig ist, die vorhandenen Gerätemöglichkeiten in vollem Maße zu
nutzen. Dann ist das Morsen ein Genuß!
Siehe auch: Tipps gegen Fremdstörungen und deren
mögliche Abhilfe
5 MHz Tipp - Vergrößerung der
Filterbandbreite
Der primäre Telegrafiebereich auf 60 Meter umfasst lediglich 2,5
kHz (5351,5 - 5354 kHz). Wird zusätzlich der Bereich oberhalb
genutzt, beispielsweise für einen Betrieb mit englischen Stationen
(andere Bandzuteilung!), vergrößert sich der Bereich nur um wenige
Kilohertz. Bei einstellbaren Filterbandbreiten von 2,7 kHz (SSB),
vielleicht auch 6 kHz (Rundfunk-)AM-Empfang, ist der CW-Bereich mit
einer einzigen RX-Einstellung nahezu komplett zu beobachten.
Lediglich die zwangsläufig höheren Töne oder ein zufälliges
Schwebungsnull (Zero Beat) können als nachteilig betrachtet werden.
So kann bei stillem Band und einer breitbandigen
Empfängereinstellung auf einer gemittelten Frequenz (z.B. 5352,75
kHz) ein erfolgreicher Stand By-Hörbetrieb stattfinden.
Besondere Z-Gruppen für die
Morsetelegrafie
Die mit den Q-Gruppen verwandten
internationalen Z-Gruppen werden primär bei kommerziellen (RTTY-) Funkdiensten genutzt.
Sie sind im Amateurfunk mit einer Ausnahme nahezu unbekannt.
Die Gruppe "ZAP" ("Bitte bestätigen!") ist überwiegend nach
Rundsprüchen (nicht Notfunknetze!) zu hören. Wird dem eigenen Rufzeichen
nach einem unmittelbaren Rundspruch zur Bestätigung "ohne ZAP"
beigefügt, gilt dies als eine Bestätigung, jedoch ohne den Wunsch
eines späteren Aufrufs der Rundspruchstation für einen erweiterten
Bestätigungsverkehr.
Neben dem im Amateurfunk bekannten "ZAP" gab es spezielle Z-Gruppen
für die Nutzung von Morsetasten. Diese sind im Amateurfunk völlig
ungebräuchlich, wohl aber für den Morse(tasten)freund sicher
erwähnenswert.
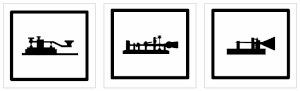 ZTH - ZTV - ZTW ZTH - ZTV - ZTW
Verwendet wurden diese Gruppen im automatischen
(Morse-) Schnellsendebetrieb (QRQ).
ZTA Senden Sie automatisch!
ZTH Senden Sie mit der Handtaste!
ZTV Senden Sie mit Vibroplex!
ZTW Senden Sie mit Wabbler!
Besondere Aufwärmübung für den
Telegrafisten
Problem: Mangelnde Übung oder kalte Finger oder Tastengewöhnung.
Generationen von Telegrafisten trainierten mit den
"Fingerbrechern":
Eine reizvolle Trockenübung wären auch andere, noch längere Wörter,
die ohne jedes Stocken flüssig (auch schnell!), und ohne einen
einzigen Fehler in "einem Rutsch" zu tasten sind.
Fingerbrecher-Beispiele:
- Haifischschwanzflossenfleischsuppe
- Leichtathletikweltmeisterschaftsentscheidungswettkampf
-
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung
Zum Trost: Auch sehr erfahrene Telegrafisten haben damit ihre
Probleme!
Spezielle Quarz-Q-Gruppen
Im frühen Amateurfunk konnten viele Funkamateure aufgrund der
Verwendung fester Sendequarze nur schwierig in Verbindung treten.
Obwohl die Empfänger in der Regel durchstimmbar waren, konnten nur
Simplexverkehre durchgeführt
werden. Für die erweiterte Betriebsmöglichkeit (Duplexbetrieb - Funkverkehr auf zwei
Frequenzen) wurden besondere Q-Gruppen verwendet. Diese
Quarz-Q-Gruppen kennzeichneten die jeweilige Methode des Abhörens.
Ein Wiederaufleben der Gruppen erfolgte in den Anfängen des
UKW-Bastelns. Heute ist dieses Verfahren in Vergessenheit geraten.
Die Q-Gruppen lassen eine Logik (High/Middle/Low) erkennen:
QHL
QHM
QLH
QLM
QMH
QML
|
Ich suche das Band, am oberen Ende beginnend ab.
Ich suche das Band, am oberen Ende beginnend zur Mitte ab.
Ich suche das Band, am unteren Ende beginnend ab.
Ich suche das Band, am unteren Ende beginnend zur Mitte ab.
Ich suche das Band, in der Mitte beginnend nach oben ab.
Ich suche das Band, in der Mitte beginnend nach unten
ab. |
Vielleicht ist dieses Verfahren auch heute noch für den (Contest-)
Betrieb zwischen quarzgesteuerten Sendern einfachster Bauart
sinnvoll?
Tönende Telegrafie auf UKW (F2A) -
Alternativ auch in SSB
UKW-Verbindungen als Chance zum
gemeinschaftlichen Morsen lernen und üben!
Durch die große Verbreitung von kleinen V/UHF-FM-Handfunkgeräten
ist der F2A- Morsebetrieb auf einem "OV-Kanal" oder auf der
F2A-Anruffrequenz 144,65 MHz eine gute und einfache Möglichkeit zum
unterstützenden Morsen lernen und üben.
Besonders mit CW-Wiedereinsteigern(!) und interessierten Freunden
können in der Gemeinschaft Kenntnisse und Fähigkeiten lokal, ganz
ohne Scheu und Reichweite trainiert und verbessert werden. Auch
eignet sich der sehr geringe Antennen- und Geräteaufwand besonders
für Interessierte und Einsteiger - gerade auch für spätere erste QSO-Schritte.
Wird in der Folge während der Telegrafiepausen über das Mikrofon
(F3E) "telefoniert", vermindert sich der anfängliche (Neu-) Stress
- bei gleichzeitig erhöhtem Spaßfaktor. Das vertrauliche
"Wohnzimmergefühl" bei den oft (sehr) geringen UKW-Reichweiten
erleichtern dabei den Mut zum (ersten) "öffentlichen" Morsen.
Tipp: Der einfachste Weg ist die
unmittelbare Mikrofon-Einkopplung via Lautsprecher
(Tongenerator/Audiosignal KW-Sender).
Tipp: Frage einfach im OV oder bei
deinen Funkfreunden nach, ob und wer vielleicht Lust zu gemeinsamen
UKW-Morseübungen hätte. Und auch als Anfänger kann man sich neben
dem reinen Lern-Hören bereits gelernete Zeichen gegenseitig
zumorsen. Hauptsache, es macht Laune!
Sind V/UHF-Allmode-Geräte vorhanden, treffen sich Morse-Übende auch
gerne in den jeweiligen SSB-Bereichen. In A1A (CW) gegebene
Übungstexte werden im Anschluss in J3E (SSB) vorgelesen und
verglichen. Auch "verkriechen" sich Übende gerne abseits im
10m-Band. Die Haupsache ist jedoch immer die Gemeinschaft und der
Mut, die reizvollen Zeichen zu üben, um dann auch mit selbst
gegebenen Morsezeichen auf das Band zu gehen. Und möchte man das
Morsen lernen oder üben, lohnt sich immer ein Seitenblick auf
regionale Ortsverbandsaktivitäten.
|
|
|
|
©
DK5KE
|
|
|